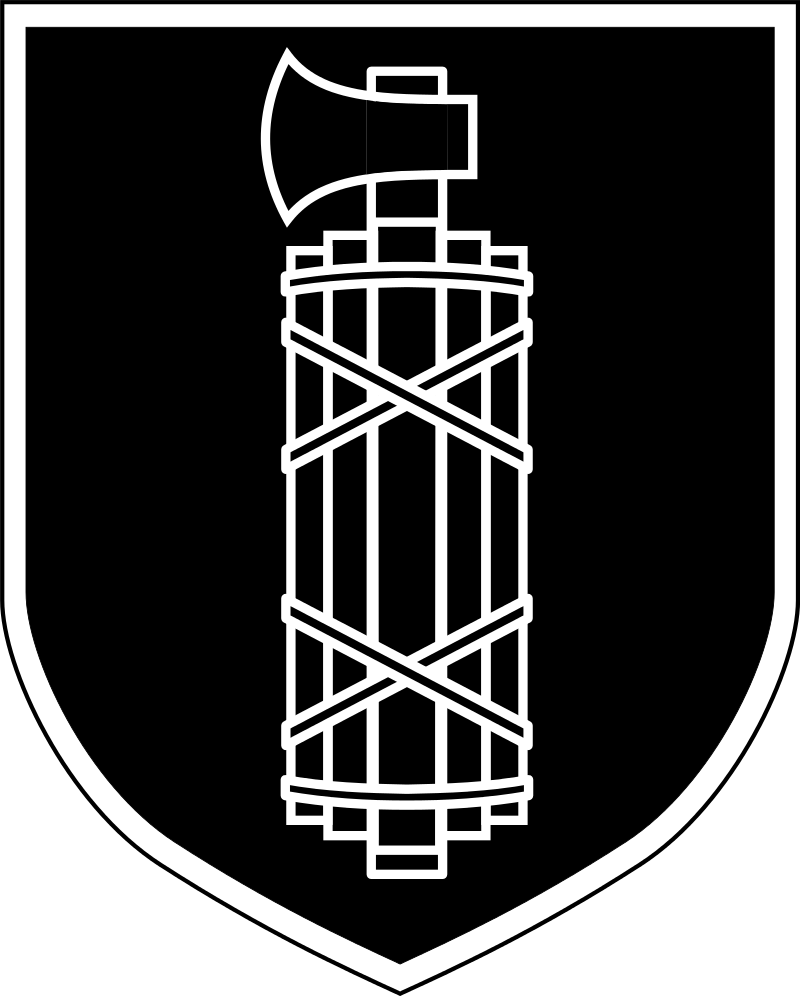„Der Geschäftsgang der Heeresleitung fängt an mir zu schleppend und zeitraubend zu werden. Ich schiebe diese Verzögerung gewiß nicht auf einen Mangel an Fleiß, sondern im Gegenteil auf ein überhandnehmen bürokratischer Sitten. Vor allem fürchte ich eine Ressorteitelkeit, die nicht zuläßt, dass mir die neue Form eines Hufnagels vorgeschlagen wird, ehe nicht T1, 2, 3, 4, V.A., J.W.G., In 1 – 7, Rechtsabteilung und Friedenskommission ihr schriftliches Votum abgegeben haben und Meinungsverschiedenheiten durch eine Besprechung der Referenten ausgeglichen sind. Ich fürchte aber noch mehr, dass über diesen Hufnagel sowohl von Seiten der Abteilungen wie der Inspektionen einzeln alle Truppenteile befragt worden sind. Wenn mir dann der Hufnagel zur Entscheidung mit allseitiger Zustimmung und der alleine maßgebenden Veterinär-Inspektion vorgelegt wird, dann sind entweder inzwischen 100 Pferde unnötig lahm geworden, oder es bleibt bei dem alten bewährten Hufnagel und Ministerium und Truppe haben umsonst gearbeitet. Ich ersuche alle Stellen der Heeresleitung, diesen Hufnagel als Symbol aufzufassen und mir zu helfen, dass uns eine bürokratische Schwerfälligkeit fern bleibt, die sich mit dem Soldatenstand nicht verträgt.“
Der Urheber des legendären Hufnagelerlasses, unser Generaloberst Hans von Seeckt, hat heute Geburtstag. Geboren wurde er 1866 in Schleswig und trat 1885 in unser deutsches Heer ein. In diesem stieg er vor dem Vierjährigen Krieg bis zum Oberstleutnant auf und war als Stabschef bei unserem III. Armeekorps tätig. Anfangs kämpfte er mit diesem im Gallien, wurde dann aber 1915 nach Osten geschickt, um bei unserer neugebildeten XI. Armee die Stelle des Stabschefs anzutreten. Geführt wurde unsere XI. Armee von unserem Feldmarschall August von Mackensen. Ihre Aufgabe bestand darin gegen die Russen eine entscheidende Durchbruchsschlacht bei Gorlice-Tarnow zu schlagen, was ihr im Mai gelang. Zum Dank für seine Verdienste erhielt unser Generaloberst von Seeckt die Beförderung zum Generalmajor und den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen. Im Herbst 1915 folgte dann der Feldzug gegen Serbien, in dem die Übeltäter von Sarajevo endlich zerschmettert worden sind. Die nächste Aufgabe bestand in der Unterstützung der Österreicher, deren Armeen er als Stabschef führte. Nach dem Dolchstoß der Novemberverbrecher trat unser Generaloberst von Seeckt beim Grenzschutz Ost in Erscheinung und wurde 1920 mit der Leitung der Reichswehr betraut. Mit dieser warf er 1923 den Aufstand der Kommunisten in Sachsen nieder. Da unser Feldherr bemüht war in die Fußstapfen Scharnhorsts zu treten, bewirkten die Landfeinde seine Absetzung. Wie so mancher italienische Staatslehrer nutzte er die Zeit der Untätigkeit zum Schreiben und dabei sind viele gute Bücher herausgekommen. In seiner wegweisenden Schrift über die Landesverteidigung lese ich ein Stück weiter: https://archive.org/details/SeecktLandesverteidigung
„Bevor wir zur Behandlung des eigentlichen Problems kommen, müssen wir uns mit einem anderen auseinandersetzen, das in die Rüstungs- und Kriegsfragen hineinspielt, dem der Neutralität. Auf die staatsrechtliche Seite soll hier nicht eingegangen werden; es bliebe aber doch vielleicht eine Lücke, wenn nicht kurz zu dem möglichen Einfluß der Neutralität auf die Rüstung Stellung genommen würde. Bei den Debatten über den zu sichernden Frieden ist auch die Frage grundsätzlicher Neutralität mehrfach aufgetaucht, nicht nur in dem Sinn der politischen Ablehnung jedes Bündnisses und jeder Verpflichtung, sofern aus ihnen militärische Konsequenzen gezogen werden können, sondern in dem eines ganz allgemeinen Desinteressements an den Händeln dieser Welt unter gleichzeitiger Unterlassung jeder Rüstung. So lange nicht der Kellogg-Pakt oder ähnliche Abmachungen, verbunden mit einer radikalen Änderung der menschlichen Natur, Kriege aus dem Bereich der Möglichkeit geschoben haben, womit ja jede besondere Neutralitätserklärung nur einen einseitigen Wert haben. Das Gleiche gilt für eine Neutralitätserklärung ad hoc, das heißt im Fall eines bewaffneten Konfliktes zwischen anderen Staaten. Ob ein Staat seine Neutralität aufrecht erhalten kann, darüber entscheiden nicht nur seine eigenen Wünsche, sondern ebenso die der anderen. Ein Staat, ob klein oder groß, der es unterlassen hat, vertrauend auf seine Neutralität, seine Selbstverteidigung zu sichern, ist eine vollkommene quantite negligeable bei einem ausbrechenden Völkerringen. Daraus folgt, daß ein Staat, der, sei es zu grundsätzlicher Neutralität entschlossen ist, sei es sich die Freiheit der Neutralität im gegebenen Fall vorbehalten will, in der Lage sein muß, diese Neutralität zu schützen. Diese Wahrheit bleibt die gleiche für alle Staaten, die einmal nicht im luftleeren Raum des ewigen Friedens, sondern inmitten nicht immer freundlicher Nachbarn leben, und je größer ein Staat ist, um so gefährdeter seine geographische Lage, um so enger seine Verknüpfung mit allen Weltvorgängen, desto dringender ist die Forderung nach einer Rüstung, die ihm die Freiheit des Entschlusses und Verhaltens sichert. Es kommt darauf an festzustellen, daß eine ausreichende Rüstung an sich keine Kriegsdrohung ist, sondern im Gegenteil eine Garantie für die Erhaltung und Sicherung des Friedens eines Landes sein kann, daß aber in der Vorenthaltung der für diese Sicherung ausreichenden Rüstung und damit der Möglichkeit genügend Selbstverteidigung eine unmittelbare Kriegsgefahr enthalten ist, auch wenn dieses Land nicht aktiver Kriegsteilnehmer, sondern gezwungenermaßen nur passiver Kriegsschauplatz für die anderen wird…“